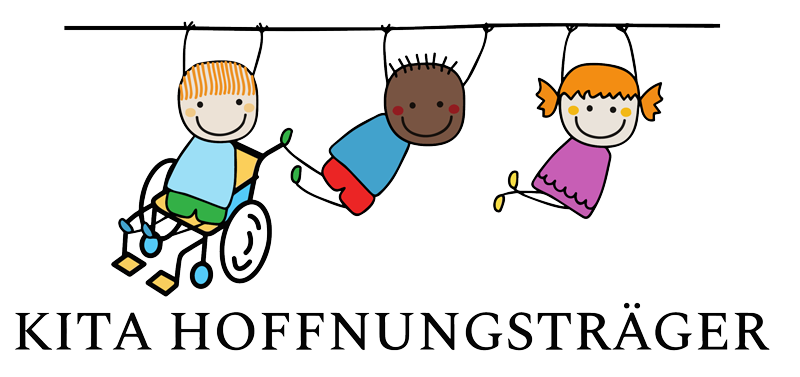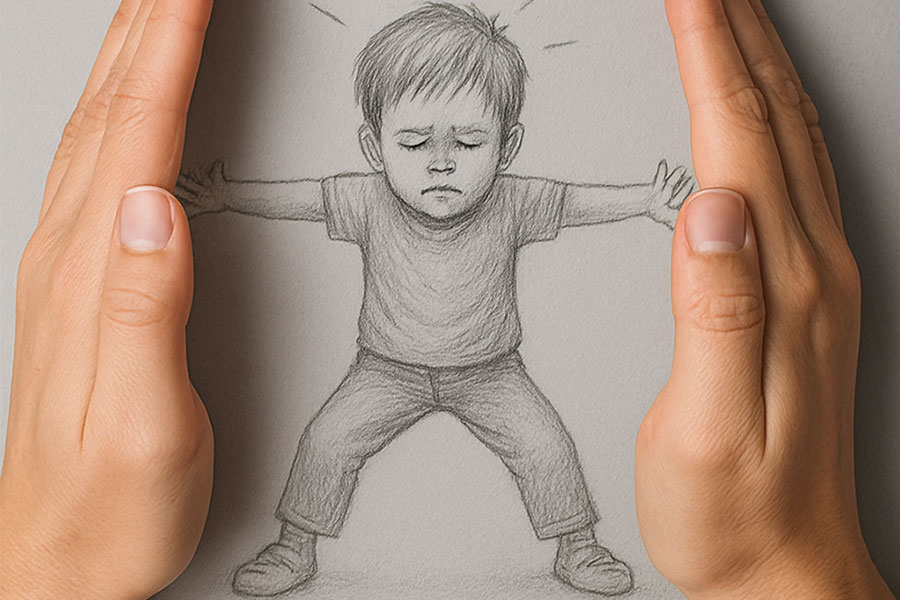Wer braucht hier eigentlich Ruhe? Kinder oder wir?
Mittagsruhe in der Kita – ein Klassiker. Nach dem Essen heißt es: ab ins Bett für die Kleinen und für die anderen „Ruhe(n) bitte!“, Doch halt mal: Ist das wirklich für alle Kinder sinnvoll? Oder ist das eher ein pädagogisches Ritual, das uns Erwachsenen eine wohlverdiente Pause verschafft?

Schlafbedürfnis ist individuell – nicht institutionell
Neurowissenschaftlich betrachtet ist das Schlafbedürfnis bei Kindern extrem unterschiedlich. Studien zeigen, dass die Differenz im Schlafbedarf bei Kleinkindern bis zu fünf Stunden betragen kann. Während das eine Kind nach dem Mittagessen in den Tiefschlaf gleitet, ist das andere hellwach und voller Tatendrang. Eine pauschale Ruhezeit ignoriert diese Unterschiede – und kann sogar kontraproduktiv sein.
Selbstregulation statt Zwangsentspannung
Kinder entwickeln ihre Fähigkeit zur Selbstregulation über Jahre hinweg. Der präfrontale Cortex, zuständig für Impulskontrolle und Aufmerksamkeit, ist bei Kita-Kindern noch mitten im Aufbau. Wenn wir sie zwingen, still zu liegen, obwohl sie nicht müde sind, fördern wir nicht Ruhe – sondern Frustration. Und mal ehrlich: Wer hat schon Lust, eine Stunde lang wach im Bett zu liegen, während alle anderen schlafen oder still und leise flüsternd am Tisch sitzen und ein Puzzle zu machen.
Pädagogische Haltung: Ruhe als Angebot, nicht als Pflicht
Eine professionelle Haltung bedeutet, Ruhephasen als Möglichkeit zu gestalten – nicht als Zwang. Kinder sollten selbst entscheiden dürfen, ob sie ruhen, lesen, malen, sich leise beschäftigen oder bewegungsaktiv im Außengelände unterwegs sind, vielleicht auch riesige Bauwerke im Bauraum kreieren. Das stärkt ihre Selbstwirksamkeit und fördert Teilhabe.
Und jetzt mal frech gefragt: Wer braucht die Pause?
Seien wir ehrlich – manchmal ist die Mittagsruhe auch unsere Rettung. Nach einem turbulenten Vormittag sehnen sich viele Fachkräfte nach einem Moment der Stille. Das ist menschlich und verständlich. Aber sollten wir deshalb Kinder in eine Ruhephase schicken, die sie gar nicht brauchen? Vielleicht ist es Zeit, unsere eigenen Bedürfnisse zu reflektieren – und kreative Wege zu finden, wie wir unsere Pausen gestalten, ohne die Kinder zu regulieren.
Verantwortung für die Wachen
Und was ist mit den Kindern, die nicht mehr schlafen? Genau hier beginnt unsere pädagogische Verantwortung. Diese Kinder brauchen Angebote – ruhige, aber anregende Impulse, die ihnen ermöglichen, sich zu beschäftigen, zu spielen, zu gestalten und genauso ausreichend Möglichkeiten sich aktiv zu bewegen. Es reicht nicht, sie „leise in der Ecke“ zu parken. Wer nicht schläft, hat ein Recht auf Teilhabe. Und wir sind verpflichtet, auch für diese Kinder präsent, aufmerksam und kreativ zu sein.
Fazit: Ruhe ist wichtig – aber nicht für alle gleich
Mittagsruhe kann wohltuend sein. Aber sie muss bedürfnisorientiert sein. Nicht jedes Kind braucht sie, und nicht jede Kita muss sie gleich gestalten. Statt starrer Routinen brauchen wir flexible Angebote, die auf die individuellen Entwicklungsphasen und das aktuelle Befinden der Kinder eingehen. Denn echte pädagogische Qualität zeigt sich nicht in der Stille – sondern in der Fähigkeit, zuzuhören, was Kinder wirklich brauchen.
Diese Beiträge könnten Ihnen auch gefallen
Bildung im Standby-Modus: Wenn Stillstand als Erfolg verkauft wird
Bewegung ist kein optionales Extra, sondern das Fundament für alle Lernprozesse. Die Entwicklung des Körpers ist untrennbar mit der Entwicklung des Gehirns verbunden. Wer Bewegung kürzt, kürzt Bildung.
Adultismus macht klein – Kita macht groß
Viele Routinen in der Kita sind von adultistischen Mustern geprägt, oft unbewusst. „So macht man das eben.“ Doch genau hier liegt die Gefahr: Wenn Kinder erfahren, dass ihre Grenzen übergangen werden, dass ihre Stimme weniger zählt, dass ihr Wille zweitrangig ist…
Der Kita-Alltag ist kein Trainingslager für die Schule – Warum wir Kinder nicht „fit machen“, sondern stark machen sollten
Partizipation ist kein pädagogisches Extra – sie ist das Fundament
Viele Fachkräfte glauben, dass ernstgemeinte Mitbestimmung in der Kita überflüssig sei, weil Kinder in der Schule ohnehin keine Wahl hätten. Aber genau das ist der Denkfehler: Wenn Kinder in der K…
Impulse für Ihre Kita sichern
Sie möchten die Qualität Ihrer pädagogischen Arbeit weiterentwickeln oder Ihr Team gezielt stärken? Unsere Fortbildungen, Coachings und Beratungen geben Ihnen praxisnahe Impulse, die sofort wirken und langfristig tragen.
FAQ
Müssen Kinder in der Kita wirklich mittags schlafen?
Nein. Das Schlafbedürfnis ist bei Kindern individuell sehr unterschiedlich. Manche brauchen nach dem Mittagessen eine Pause oder ein Nickerchen, andere sind hellwach und voller Energie. Eine verpflichtende Schlafenszeit wird diesen Unterschieden nicht gerecht und kann sogar Frust auslösen.
Warum ist es problematisch, Kinder zum Ruhen zu zwingen, wenn sie nicht müde sind?
Wenn Kinder gezwungen werden, still zu liegen, obwohl sie gar nicht müde sind, erleben sie Stress statt Entspannung. Ihr Gehirn – insbesondere der präfrontale Cortex, der für Impulskontrolle zuständig ist – befindet sich noch in der Entwicklung. Statt Selbstregulation zu fördern, entsteht eher Unruhe oder Widerstand.
Wie kann Ruhezeit kindgerecht gestaltet werden?
Ruhen sollte ein Angebot, keine Pflicht sein. Kinder können selbst wählen, ob sie schlafen, leise lesen, malen oder draußen spielen möchten. So erleben sie Selbstwirksamkeit und lernen, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten – ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstregulation.
Was können Fachkräfte tun, wenn sie selbst eine Pause brauchen?
Auch pädagogische Fachkräfte brauchen Erholungsphasen – das ist völlig legitim. Wichtig ist, diese nicht auf Kosten der Kinder zu organisieren. Besser sind flexible Teamlösungen oder kurze Wechselzeiten, damit Erwachsene durchatmen können, während Kinder sinnvoll beschäftigt sind.
Wie profitieren wache Kinder von einer bedürfnisorientierten Ruhezeit?
Kinder, die nicht schlafen, gewinnen durch gezielte, ruhige Angebote – etwa kreative, motorische oder gestalterische Aktivitäten. So bleiben sie in ihrem eigenen Rhythmus aktiv und fühlen sich trotzdem einbezogen. Das stärkt Teilhabe, Selbstbestimmung und soziale Kompetenz.