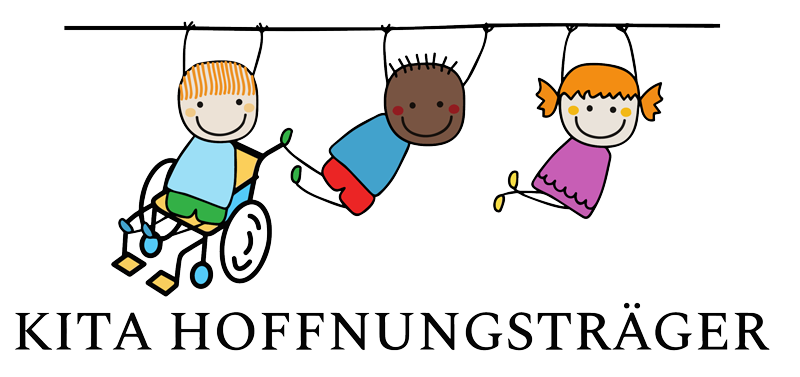Adultismus macht klein – Kita macht groß.
„Kinder sollen sich anpassen – in der Schule müssen sie das auch.“
„Sie sind noch zu klein, um richtige Entscheidungen zu treffen.“
„Wir Großen wissen besser, was gut für sie ist.“
„Du musst am Stuhlkreis teilnehmen, du musst lernen dich zu konzentrieren.“
„Ich wickele dich jetzt, ob du willst oder nicht.“
Diese Sätze sind gefährlich, denn sie zeigen, wie tief Adultismus in unserem Alltag verankert ist. Adultismus ist keine individuelle Schuldfrage, sondern ein strukturelles Problem: die Gewohnheit, Kinder klein zu machen, weil wir groß sind. Aber Kita darf kein Ort sein, an dem Macht über Kinder ausgeübt wird, sie muss ein Ort sein, an dem Kinder lernen, dass sie gleichwürdig und wertvoll sind.
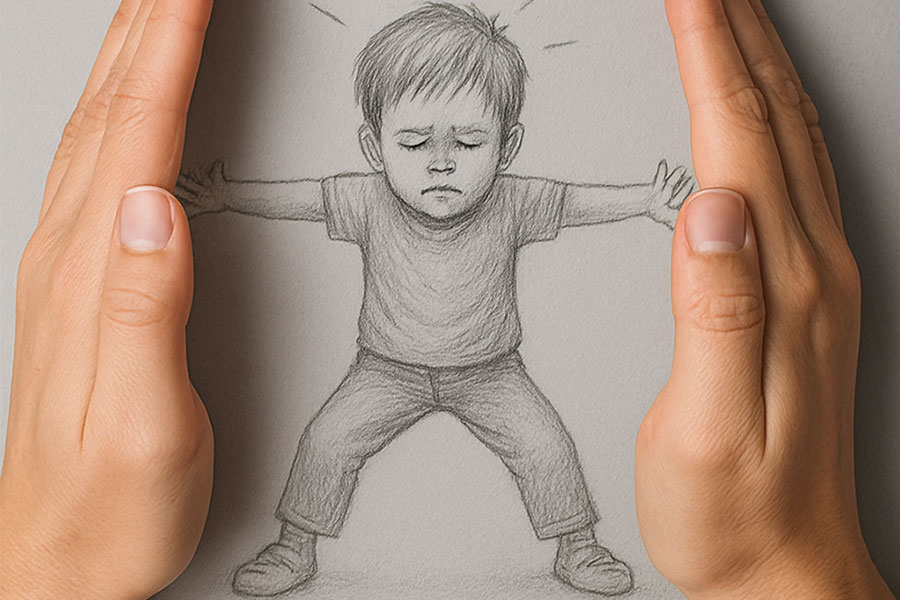
Adultismus ist kein Randthema – er ist ein Bildungsrisiko
Viele Routinen in der Kita sind von adultistischen Mustern geprägt, oft unbewusst. „So macht man das eben.“ Doch genau hier liegt die Gefahr: Wenn Kinder erfahren, dass ihre Grenzen übergangen werden, dass ihre Stimme weniger zählt, dass ihr Wille zweitrangig ist – dann lernen sie nicht Selbstbewusstsein, sondern Anpassung. Und Anpassung ist kein Bildungsziel.
Wer Adultismus nicht hinterfragt, verhindert echte Bildung. Denn Bildung heißt nicht: „Ich funktioniere.“ Bildung heißt: „Ich erkenne meinen Wert.“
Was Kinder wirklich erleben sollten – und was Adultismus ihnen raubt
- Gleichwürdigkeit: Ich bin nicht weniger wert, nur weil ich jünger bin.
- Selbstwirksamkeit: Ich darf Einfluss nehmen – und sehe, dass es etwas verändert.
- Grenzachtung: Mein Körper gehört mir – und das wird respektiert.
- Dialog: Meine Meinung wird gehört – nicht übergangen.
- Vertrauen: Erwachsene trauen mir etwas zu – und ich mir selbst.
Diese Erfahrungen sind keine „Extras“! Sie sind die Basis für ein starkes Leben. Und sie entstehen nicht durch Vorschriften, sondern durch echte Begegnung auf Augenhöhe.
Kita ist kein Ort für Machtgefälle – sie ist ein Ort für Demokratie
Wenn wir Kinder aus der Kita entlassen, sollten sie nicht gelernt haben, „klein zu bleiben“. Sie sollten gelernt haben, groß zu denken. Mit Mut. Mit Haltung. Mit dem Bewusstsein: „Ich bin wichtig. Ich darf Nein sagen. Ich darf Ja sagen.“
Denn die Erwachsenenwelt kommt früh genug. Aber die Chance, Machtverhältnisse zu hinterfragen und Kinder stark zu machen, haben wir nur jetzt.
Fazit: „Adultismus macht klein – Kita macht groß und lebendig.
Also, liebe Kolleg*innen: Lasst uns nicht gegen Kinder arbeiten, sondern mit ihnen. Lasst uns Routinen prüfen, Haltungen reflektieren und Strukturen verändern. Mit Respekt. Mit echter Anerkennung. Mit echter Haltung.
Denn wer Kinder gleichwürdig behandelt, verändert die Welt. Und das beginnt nicht irgendwann – das beginnt in der Kita.
Diese Beiträge könnten Ihnen auch gefallen
Bildung im Standby-Modus: Wenn Stillstand als Erfolg verkauft wird
Bewegung ist kein optionales Extra, sondern das Fundament für alle Lernprozesse. Die Entwicklung des Körpers ist untrennbar mit der Entwicklung des Gehirns verbunden. Wer Bewegung kürzt, kürzt Bildung.
Der Kita-Alltag ist kein Trainingslager für die Schule – Warum wir Kinder nicht „fit machen“, sondern stark machen sollten
Partizipation ist kein pädagogisches Extra – sie ist das Fundament
Viele Fachkräfte glauben, dass ernstgemeinte Mitbestimmung in der Kita überflüssig sei, weil Kinder in der Schule ohnehin keine Wahl hätten. Aber genau das ist der Denkfehler: Wenn Kinder in der K…
Selbstbestimmung in der U3 – Warum wir den Kleinsten endlich zuhören müssen!
Sie sind 0,4 bis 3 Jahre alt. Sie sabbern, stolpern, brabbeln – und sie sind verdammt kompetent. Kinder in der U3-Gruppe sind keine hilflosen Wesen, die man „bespielen“ muss, bis sie endlich sprechen können. Sie sind Menschen mit Bedürfnissen, Meinungen und eine…
Impulse für Ihre Kita sichern
Sie möchten die Qualität Ihrer pädagogischen Arbeit weiterentwickeln oder Ihr Team gezielt stärken? Unsere Fortbildungen, Coachings und Beratungen geben Ihnen praxisnahe Impulse, die sofort wirken und langfristig tragen.
FAQ
Was bedeutet Adultismus in der Kita?
Adultismus beschreibt die Haltung, Kinder aufgrund ihres Alters weniger ernst zu nehmen oder ihnen Macht abzusprechen. In der Kita zeigt sich das oft in Regeln, Routinen oder Entscheidungen, die Kindern wenig Mitbestimmung ermöglichen.
Warum ist Adultismus ein Risiko für die kindliche Entwicklung?
Kinder, deren Grenzen oder Meinungen regelmäßig übergangen werden, entwickeln eher Anpassung statt Selbstbewusstsein. Das schadet ihrer Selbstwirksamkeit, also dem Gefühl „Ich kann etwas bewirken“.
Wie erkenne ich adultistische Strukturen im Kita-Alltag?
Typische Hinweise sind starre Abläufe ohne Wahlmöglichkeiten, Formulierungen wie „Du musst das jetzt machen“ oder Entscheidungen, die ohne Erklärung durchgesetzt werden. Auch Körperpflege gegen den Willen des Kindes ist ein Warnsignal.
Wie kann ein Team adultistische Muster abbauen?
Durch Reflexion, klare Werte, transparente Kommunikation und echte Beteiligung der Kinder. Hilfreich sind Teamgespräche, Fallbesprechungen und Fortbildungen, die die eigene Haltung in den Blick nehmen.
Welche Rolle spielt Partizipation beim Abbau von Adultismus?
Partizipation stärkt Kinder, weil sie erleben, dass ihre Meinung zählt. Sie lernen Grenzen zu setzen, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu verstehen. Das schützt vor Machtgefällen und fördert demokratisches Handeln.