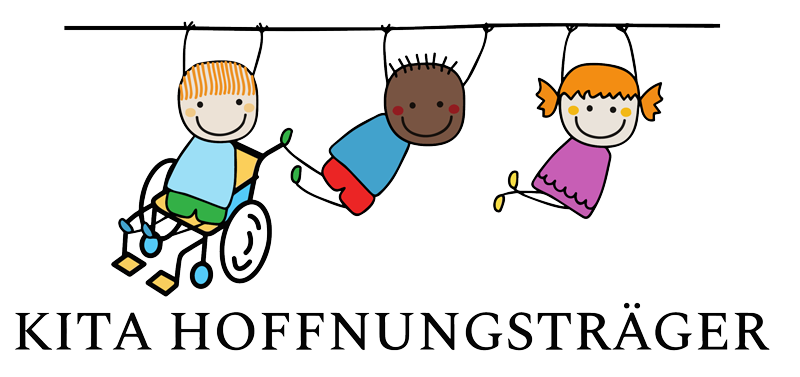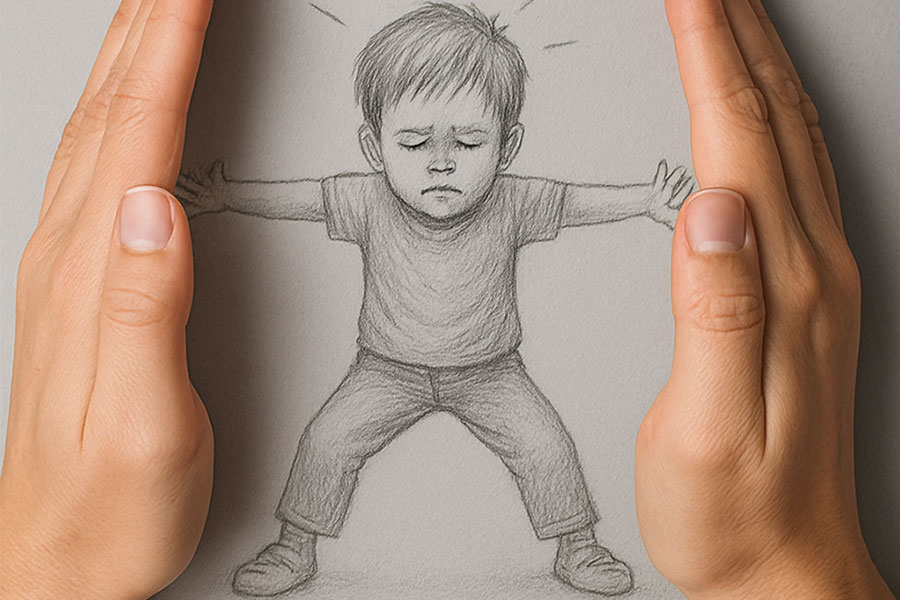Bildungsdokumentation – Warum sie oft mehr über die Fachkraft aussagt als über das Kind
Triggerwarnung für laminierte Bastelangebote und pädagogische Selbsttäuschung: Dieser Text könnte Ihre Portfolio-Idylle erschüttern.

Die Bildungsdokumentation – eigentlich eine gute Idee
Sie soll zeigen, was Kinder lernen, wie sie sich entwickeln, was sie bewegt. Sie soll Prozesse sichtbar machen, individuelle Wege würdigen und die pädagogische Haltung spiegeln. Klingt nach einem Schatz. Ist aber oft ein Schaukasten – für die Fachkraft.
Denn was in vielen Kitas als „Portfolioarbeit“ verkauft wird, ist in Wahrheit eine pädagogische Inszenierung. Willkommen in der Portfoliolüge.
Die Portfoliolüge – wenn Dokumentation zur Dekoration wird
- Die Erzieherin macht die Fotos.
- Die Erzieherin schreibt die Texte.
- Die Erzieherin klebt die Seiten ein.
- Das Kind darf ausmalen. Oder ein Arbeitsblatt ausfüllen. Oder ein vorgefertigtes „Ich bin 4 Jahre“-Blatt gestalten.
Und am Ende entsteht ein hübsches Heft, das aussieht wie ein Werbeprospekt für pädagogische Qualität – aber wenig mit echter Bildungsdokumentation zu tun hat.
Denn wenn Kinder nicht mitentscheiden dürfen, was dokumentiert wird, wie es dargestellt wird und was für sie wichtig ist, dann dokumentieren wir nicht ihre Bildung – sondern unsere Vorstellung davon.
Bildungsdokumentation als Spiegel der Haltung
Was sagt ein Portfolio, das nur aus Fotos beim Basteln, Turnen und Geburtstagsfeiern besteht?
Was sagt ein Portfolio, das keine Kinderstimme enthält?
Was sagt ein Portfolio, das aussieht wie ein Katalog?
Es sagt: Die Fachkraft hat dokumentiert, was sie für zeigbar hält. Nicht, was das Kind für bedeutsam hält.
Und das ist ein Problem. Denn echte Bildungsdokumentation ist kein pädagogisches Showreel – sie ist ein Dialog. Zwischen Kind und Fachkraft. Zwischen Alltag und Bedeutung. Zwischen Tun und Verstehen.
Was echte Bildungsdokumentation braucht
- Kinderbeteiligung: Kinder entscheiden mit, was dokumentiert wird.
- Prozessfokus: Nicht das Endprodukt zählt, sondern der Weg dahin.
- Offene Formate: Zeichnungen, Gespräche, Fotos, Beobachtungen – nicht nur laminierte Bastelarbeiten.
- Reflexion statt Repräsentation: Was hat das Kind gelernt? Was hat es bewegt? Was hat es verändert?
Fazit: Wer dokumentiert, sollte sich selbst hinterfragen
Bildungsdokumentation ist ein mächtiges Werkzeug – aber nur, wenn es ehrlich eingesetzt wird. Wer nur zeigt, was gut aussieht, dokumentiert nicht Bildung, sondern Imagepflege.
Also, liebe Kolleg*innen: Lasst uns aufhören, Portfolios als pädagogische Alibihefte zu führen. Lasst uns anfangen, Kinder wirklich zu beteiligen. Denn ein Portfolio, das vom Kind mitgestaltet wird, ist nicht nur authentisch – es ist ein Stück gelebte Partizipation.
Und das ist mehr wert als jedes laminierte Handabdruckbild.
Diese Beiträge könnten Ihnen auch gefallen
Bildung im Standby-Modus: Wenn Stillstand als Erfolg verkauft wird
Bewegung ist kein optionales Extra, sondern das Fundament für alle Lernprozesse. Die Entwicklung des Körpers ist untrennbar mit der Entwicklung des Gehirns verbunden. Wer Bewegung kürzt, kürzt Bildung.
Adultismus macht klein – Kita macht groß
Viele Routinen in der Kita sind von adultistischen Mustern geprägt, oft unbewusst. „So macht man das eben.“ Doch genau hier liegt die Gefahr: Wenn Kinder erfahren, dass ihre Grenzen übergangen werden, dass ihre Stimme weniger zählt, dass ihr Wille zweitrangig ist…
Der Kita-Alltag ist kein Trainingslager für die Schule – Warum wir Kinder nicht „fit machen“, sondern stark machen sollten
Partizipation ist kein pädagogisches Extra – sie ist das Fundament
Viele Fachkräfte glauben, dass ernstgemeinte Mitbestimmung in der Kita überflüssig sei, weil Kinder in der Schule ohnehin keine Wahl hätten. Aber genau das ist der Denkfehler: Wenn Kinder in der K…
Impulse für Ihre Kita sichern
Sie möchten die Qualität Ihrer pädagogischen Arbeit weiterentwickeln oder Ihr Team gezielt stärken? Unsere Fortbildungen, Coachings und Beratungen geben Ihnen praxisnahe Impulse, die sofort wirken und langfristig tragen.
FAQ
Warum wird die Selbstbestimmung von U3-Kindern oft übergangen?
Weil ihre Kommunikation häufig unterschätzt wird. Viele Erwachsene deuten nonverbale Signale nicht als Ausdruck von Bedürfnissen oder Entscheidungen – dabei sagen Blicke, Gesten und Körperhaltungen oft mehr als Worte.
Können Kinder unter drei überhaupt mitbestimmen?
Ja – auf ihre Weise. Schon Babys zeigen deutlich, was sie wollen oder ablehnen. Pädagogische Fachkräfte können diese Signale lesen und entsprechend handeln – das ist gelebte Partizipation.
Was bedeutet Selbstwirksamkeit bei Kleinkindern?
Selbstwirksamkeit heißt: Ich kann etwas bewirken. Wenn Kinder erleben, dass ihre Handlungen Einfluss haben, stärkt das ihr Selbstvertrauen, ihre emotionale Stabilität und ihre soziale Kompetenz.
Wie können Fachkräfte die Selbstbestimmung im Alltag fördern?
Indem sie aufmerksam beobachten, Alternativen anbieten („Möchtest du den roten oder blauen Becher?“), und nonverbale Kommunikation ernst nehmen. Es geht um Begegnung auf Augenhöhe – auch ohne Worte.
Was können Teams tun, um ihre Haltung gegenüber U3-Kindern zu reflektieren?
Regelmäßige Fallbesprechungen, Fortbildungen zu frühkindlicher Entwicklung und offene Teamgespräche helfen, unbewusste Routinen zu erkennen. Haltung zeigt sich nicht in Worten, sondern im Handeln – jeden Tag.