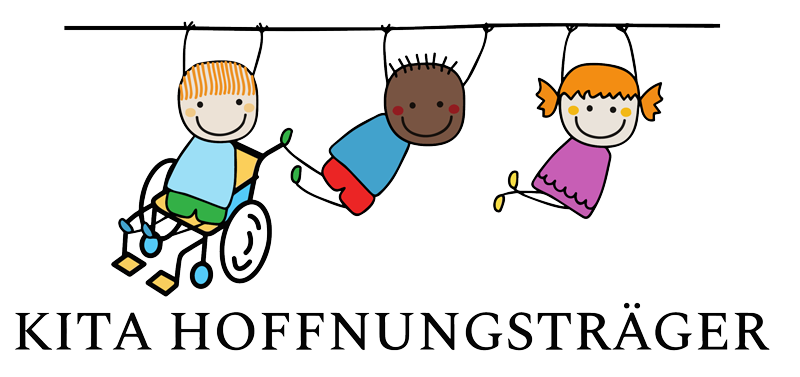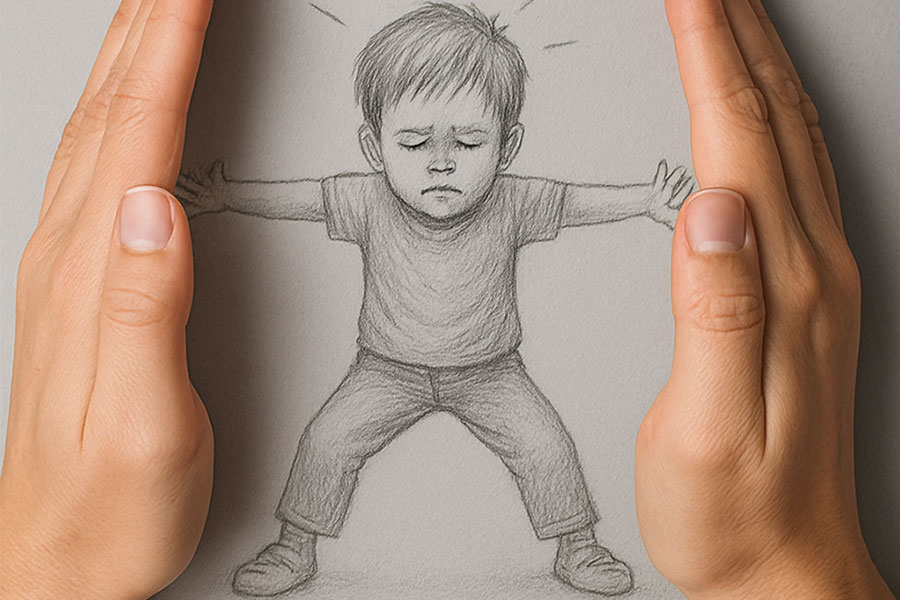Selbstbestimmung in der U3 – Warum wir den Kleinsten endlich zuhören müssen!
Triggerwarnung für pädagogische Bequemlichkeit: Dieser Text könnte Ihre Haltung erschüttern. Und das ist auch gut so.

Die Kleinsten – die am meisten übergangen werden
Sie sind 0,4 bis 3 Jahre alt. Sie sabbern, stolpern, brabbeln – und sie sind verdammt kompetent. Kinder in der U3-Gruppe sind keine hilflosen Wesen, die man „bespielen“ muss, bis sie endlich sprechen können. Sie sind Menschen mit Bedürfnissen, Meinungen und einer klaren Vorstellung davon, was sie wollen – und was nicht.
Und trotzdem: In deutschen Kitas wird ihre Selbstbestimmung regelmäßig ignoriert, übergangen oder – schlimmer noch – gar nicht erst erkannt. Warum? Weil viele Fachkräfte nie gelernt haben, wie diese Altersgruppe kommuniziert. Weil Entwicklungspsychologie und Neurologie in der Ausbildung oft nur Randnotizen sind. Und weil wir Erwachsenen immer noch glauben, dass Macht mit Größe kommt.
„Aber sie können doch noch gar nicht reden!“
Stimmt. Aber sie kommunizieren. Und zwar ständig.
• Ein abgewandter Blick ist ein Nein.
• Ein ausgestreckter Arm ist ein Wunsch.
• Ein Wutanfall ist keine „Trotzphase“, sondern ein Ausdruck von Frustration, weil sie nicht gehört wurden.
Die Hirnforschung zeigt uns längst: Selbstwirksamkeit ist ein Grundbedürfnis – auch bei Babys. Wenn ein Kind merkt, dass es Einfluss auf seine Umgebung hat, wächst sein Selbstbewusstsein, seine emotionale Stabilität und seine Fähigkeit zur sozialen Interaktion. Wer das ignoriert, verhindert Entwicklung.
Fachkräftemangel trifft Haltungsmangel
Ja, der Personalschlüssel ist mies. Ja, der Alltag ist stressig. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, Kindern systematisch ihre Mitbestimmung zu verweigern. Es ist eine Einladung, die eigene Haltung zu überdenken.
Denn wer glaubt, dass ein Kind erst mit drei Jahren „mitreden“ darf, hat das Prinzip von Partizipation nicht verstanden. Selbstbestimmung beginnt nicht mit dem ersten vollständigen Satz – sie beginnt mit dem ersten Blickkontakt.
Was wir stattdessen tun (und lassen) sollten
• Beobachten statt bewerten: Nicht jedes „Nein“ ist ein Machtspiel. Manchmal ist es einfach ein Nein.
• Fragen statt entscheiden: „Möchtest du den roten oder den blauen Becher?“ ist besser als „Hier, trink.“
• Zuhören statt übergehen: Auch nonverbale Kommunikation ist Kommunikation. Und sie ist verdammt ehrlich.
Fazit: Selbstbestimmung ist kein Luxus – sie ist Menschenrecht
Kinder unter drei sind keine Objekte der Fürsorge. Sie sind Subjekte ihrer eigenen Entwicklung. Wer das nicht erkennt, arbeitet nicht pädagogisch, sondern verwaltend. Und wer das ändern will, muss bei sich selbst anfangen.
Also, liebe Kolleg:innen: Weniger „Ich weiß, was gut für dich ist“ – mehr „Was brauchst du gerade?“
Denn Selbstbestimmung beginnt mit Selbstreflexion. Und die ist – Überraschung! – auch für Erwachsene möglich.
Diese Beiträge könnten Ihnen auch gefallen
Bildung im Standby-Modus: Wenn Stillstand als Erfolg verkauft wird
Bewegung ist kein optionales Extra, sondern das Fundament für alle Lernprozesse. Die Entwicklung des Körpers ist untrennbar mit der Entwicklung des Gehirns verbunden. Wer Bewegung kürzt, kürzt Bildung.
Adultismus macht klein – Kita macht groß
Viele Routinen in der Kita sind von adultistischen Mustern geprägt, oft unbewusst. „So macht man das eben.“ Doch genau hier liegt die Gefahr: Wenn Kinder erfahren, dass ihre Grenzen übergangen werden, dass ihre Stimme weniger zählt, dass ihr Wille zweitrangig ist…
Der Kita-Alltag ist kein Trainingslager für die Schule – Warum wir Kinder nicht „fit machen“, sondern stark machen sollten
Partizipation ist kein pädagogisches Extra – sie ist das Fundament
Viele Fachkräfte glauben, dass ernstgemeinte Mitbestimmung in der Kita überflüssig sei, weil Kinder in der Schule ohnehin keine Wahl hätten. Aber genau das ist der Denkfehler: Wenn Kinder in der K…
Impulse für Ihre Kita sichern
Sie möchten die Qualität Ihrer pädagogischen Arbeit weiterentwickeln oder Ihr Team gezielt stärken? Unsere Fortbildungen, Coachings und Beratungen geben Ihnen praxisnahe Impulse, die sofort wirken und langfristig tragen.
FAQ
Warum wird die Selbstbestimmung von U3-Kindern oft übergangen?
Weil ihre Kommunikation häufig unterschätzt wird. Viele Erwachsene deuten nonverbale Signale nicht als Ausdruck von Bedürfnissen oder Entscheidungen – dabei sagen Blicke, Gesten und Körperhaltungen oft mehr als Worte.
Können Kinder unter drei überhaupt mitbestimmen?
Ja – auf ihre Weise. Schon Babys zeigen deutlich, was sie wollen oder ablehnen. Pädagogische Fachkräfte können diese Signale lesen und entsprechend handeln – das ist gelebte Partizipation.
Was bedeutet Selbstwirksamkeit bei Kleinkindern?
Selbstwirksamkeit heißt: Ich kann etwas bewirken. Wenn Kinder erleben, dass ihre Handlungen Einfluss haben, stärkt das ihr Selbstvertrauen, ihre emotionale Stabilität und ihre soziale Kompetenz.
Wie können Fachkräfte die Selbstbestimmung im Alltag fördern?
Indem sie aufmerksam beobachten, Alternativen anbieten („Möchtest du den roten oder blauen Becher?“), und nonverbale Kommunikation ernst nehmen. Es geht um Begegnung auf Augenhöhe – auch ohne Worte.
Was können Teams tun, um ihre Haltung gegenüber U3-Kindern zu reflektieren?
Regelmäßige Fallbesprechungen, Fortbildungen zu frühkindlicher Entwicklung und offene Teamgespräche helfen, unbewusste Routinen zu erkennen. Haltung zeigt sich nicht in Worten, sondern im Handeln – jeden Tag.