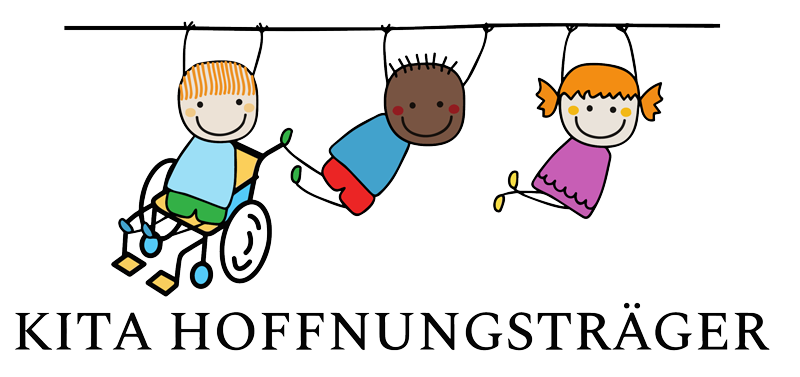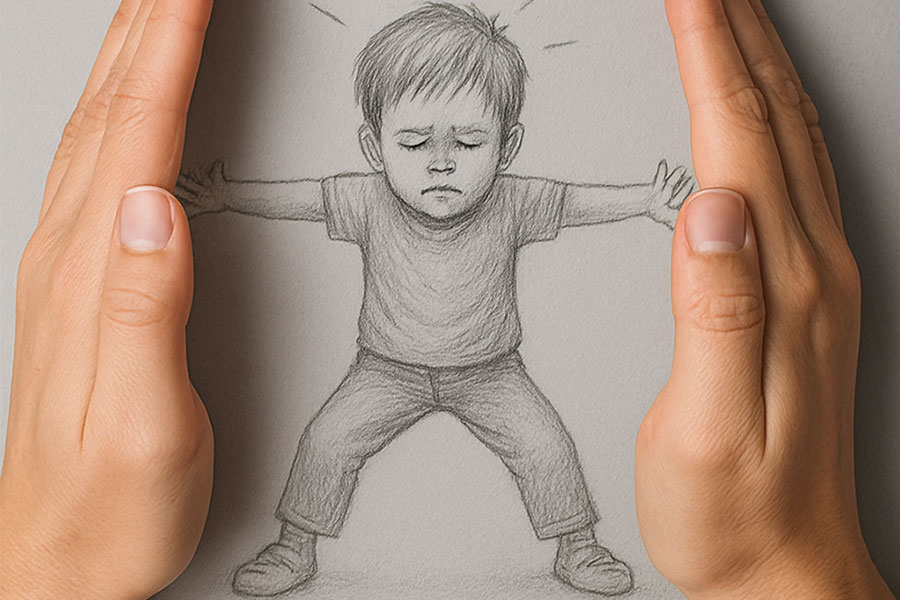Der Kita-Alltag ist kein Trainingslager für die Schule – Warum wir Kinder nicht „fit machen“, sondern stark machen sollten
Für alle, die glauben, Vorschulkinder müssten schon „funktionieren“ – dieser Text könnte Ihre Haltung ins Wanken bringen.

Kita als Vorbereitungsort? Nein. Kita als Bildungsort? Unbedingt!
„Die Kita soll die Kinder auf die Schule vorbereiten.“
„Sie müssen lernen, still zu sitzen, sich zu konzentrieren, Regeln zu befolgen.“
„Partizipation ist schön, aber in der Schule interessiert das eh keinen mehr.“
Diese Aussagen höre ich regelmäßig – und sie sind brandgefährlich. Denn sie verkennen die eigentliche Aufgabe der Kita: Sie ist kein Vorhof zur Schule, sondern ein eigenständiger Bildungsort. Und Bildung heißt nicht „ruhig sein und funktionieren“. Bildung heißt: sich selbst erkennen, sich ausdrücken, sich behaupten.
Partizipation ist kein pädagogisches Extra – sie ist das Fundament
Viele Fachkräfte glauben, dass ernstgemeinte Mitbestimmung in der Kita überflüssig sei, weil Kinder in der Schule ohnehin keine Wahl hätten. Aber genau das ist der Denkfehler: Wenn Kinder in der Kita nicht lernen, dass ihre Meinung zählt, dass sie mitgestalten dürfen, dass sie Grenzen setzen können – wie sollen sie später selbstbewusst durchs Leben gehen?
Wer Partizipation in der Kita verweigert, verweigert Kindern die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Und das ist keine Kleinigkeit – das ist ein Bildungsdefizit.
Was Kinder wirklich lernen sollten – und was wir ihnen oft vorenthalten
• Selbstbewusstsein: Ich darf sagen, was ich denke.
• Meinungsstärke: Ich darf widersprechen, diskutieren, verhandeln.
• Resilienz: Ich darf Fehler machen und daraus lernen.
• Grenzbewusstsein: Ich darf entscheiden, wer mich berührt, wer mir zu nahe kommt.
• Empathie: Ich lerne, andere zu verstehen – nicht nur zu befolgen.
Diese Kompetenzen sind nicht „nice to have“ – sie sind essenziell. Und sie entstehen nicht durch Vorschulhefte, sondern durch echte Beziehung, echte Beteiligung und echte Anerkennung.
Schule ist nicht das Ziel – das Leben ist es
Wenn wir Kinder aus der Kita entlassen, sollten sie nicht „schulfähig“ sein – sie sollten lebensfähig sein. Mit Haltung. Mit Mut. Mit einem inneren Kompass, der ihnen sagt: „Ich bin wichtig. Ich darf mitreden. Ich darf Nein sagen.“
Denn die Schule kommt früh genug. Aber die Chance, ein starkes Fundament zu legen, haben wir nur jetzt.
Fazit: Kita ist kein Trainingslager – sie ist der erste Bildungsort für Demokratie
Also, liebe Kolleg*innen: Lasst uns aufhören, Kinder auf ein System vorzubereiten, das sie klein macht. Lasst uns anfangen, sie groß zu machen. Mit echter Partizipation. Mit echter Bildung. Mit echter Haltung.
Denn wer Kinder stark macht, macht die Welt besser. Und das beginnt nicht in der Schule – das beginnt in der Kita.
Diese Beiträge könnten Ihnen auch gefallen
Bildung im Standby-Modus: Wenn Stillstand als Erfolg verkauft wird
Bewegung ist kein optionales Extra, sondern das Fundament für alle Lernprozesse. Die Entwicklung des Körpers ist untrennbar mit der Entwicklung des Gehirns verbunden. Wer Bewegung kürzt, kürzt Bildung.
Adultismus macht klein – Kita macht groß
Viele Routinen in der Kita sind von adultistischen Mustern geprägt, oft unbewusst. „So macht man das eben.“ Doch genau hier liegt die Gefahr: Wenn Kinder erfahren, dass ihre Grenzen übergangen werden, dass ihre Stimme weniger zählt, dass ihr Wille zweitrangig ist…
Selbstbestimmung in der U3 – Warum wir den Kleinsten endlich zuhören müssen!
Sie sind 0,4 bis 3 Jahre alt. Sie sabbern, stolpern, brabbeln – und sie sind verdammt kompetent. Kinder in der U3-Gruppe sind keine hilflosen Wesen, die man „bespielen“ muss, bis sie endlich sprechen können. Sie sind Menschen mit Bedürfnissen, Meinungen und eine…
Impulse für Ihre Kita sichern
Sie möchten die Qualität Ihrer pädagogischen Arbeit weiterentwickeln oder Ihr Team gezielt stärken? Unsere Fortbildungen, Coachings und Beratungen geben Ihnen praxisnahe Impulse, die sofort wirken und langfristig tragen.
FAQ
Warum wird die Selbstbestimmung von U3-Kindern oft übergangen?
Weil ihre Kommunikation häufig unterschätzt wird. Viele Erwachsene deuten nonverbale Signale nicht als Ausdruck von Bedürfnissen oder Entscheidungen – dabei sagen Blicke, Gesten und Körperhaltungen oft mehr als Worte.
Können Kinder unter drei überhaupt mitbestimmen?
Ja – auf ihre Weise. Schon Babys zeigen deutlich, was sie wollen oder ablehnen. Pädagogische Fachkräfte können diese Signale lesen und entsprechend handeln – das ist gelebte Partizipation.
Was bedeutet Selbstwirksamkeit bei Kleinkindern?
Selbstwirksamkeit heißt: Ich kann etwas bewirken. Wenn Kinder erleben, dass ihre Handlungen Einfluss haben, stärkt das ihr Selbstvertrauen, ihre emotionale Stabilität und ihre soziale Kompetenz.
Wie können Fachkräfte die Selbstbestimmung im Alltag fördern?
Indem sie aufmerksam beobachten, Alternativen anbieten („Möchtest du den roten oder blauen Becher?“), und nonverbale Kommunikation ernst nehmen. Es geht um Begegnung auf Augenhöhe – auch ohne Worte.
Was können Teams tun, um ihre Haltung gegenüber U3-Kindern zu reflektieren?
Regelmäßige Fallbesprechungen, Fortbildungen zu frühkindlicher Entwicklung und offene Teamgespräche helfen, unbewusste Routinen zu erkennen. Haltung zeigt sich nicht in Worten, sondern im Handeln – jeden Tag.